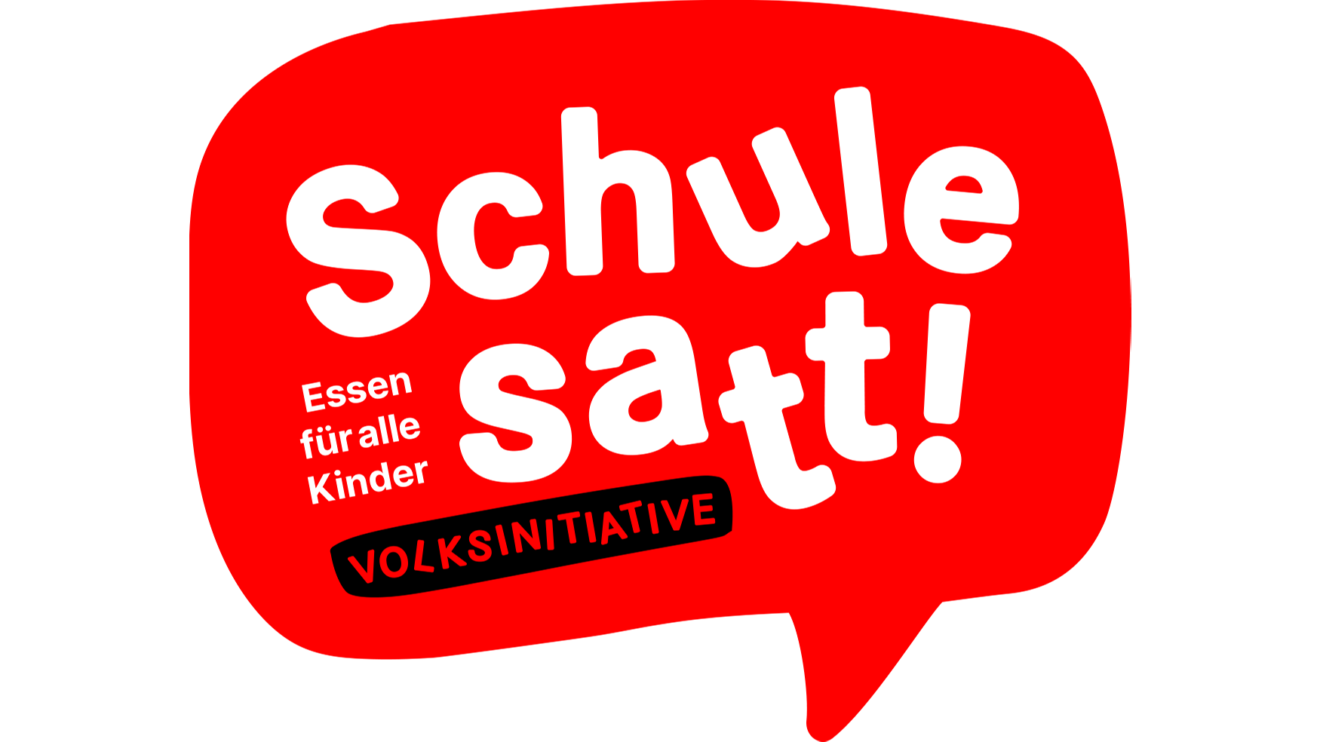
Volksinitiative „Schule satt!“
Jedes Kind in Brandenburg hat das Recht, gesund und glücklich aufzuwachsen. Dazu gehört auch eine vollwertige Ernährung. Doch das Mittagessen an einer Brandenburger Grundschule kostet mittlerweile häufig zwischen 5,- und 6,- Euro – pro Tag! Das bedeutet für eine Familie mit zwei Kindern im Grundschulalter Kosten von 200 bis 250 Euro pro Monat.
Wir wollen endlich ein beitragsfreies Mittagessen für alle Schüler*innen der 1. bis 6. Klassen an allen brandenburgischen Schulen. Hilf mit! Mit Deiner Unterschrift oder beim Sammeln von Unterschriften. Für unsere Kinder!
Mitmachen
Fünf Gründe für die Mitgliedschaft
- Gemeinsam mit mehreren zehntausend Mitglieder kannst du wirklich etwas bewegen.
- Als Mitglied hast du volles Stimmrecht: Du entscheidest vor Ort über Programm, Kandidat:innen und Vorstände.
- Du kannst dich vernetzen und viele andere nette Leute kennenlernen.
- Mit deinem Migliedsbeitrag unterstützt du die einzige größere Partei, die sich nicht von Konzernen & Co. finanzieren lässt.
- Ob Fahrradtour, Kneipendiskussion, Sommerfeste, Skatturnier oder Weiterbildungen: Wir haben ein vielseitiges Veranstaltungsangebot für dich.
Mitglied werden ist ganz einfach und geht am besten online.
Jetzt Mitglied werden!
Deine Spende hilft!
Mitmachen ohne Mitgliedschaft
Im Wahlkampf unterstützen
Auf dem Laufenden bleiben
Partei

Landesparteitag
Der Landesparteitag ist das höchste Organ des Landesverbands Brandenburg. Er berät und beschließt über grundsätzliche politische und organisatorische Fragen. Er wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Ihm vorbehalten ist u.a. die Beschlussfassung über die politische Ausrichtung, die Grundsätze und das Programm, die Satzung, die Wahlprogramme zu Landtagswahlen und die Rahmenwahlprogramme zu Kommunalwahlen, die grundsätzlichen Richtlinien zur Finanzierung der politischen Arbeit, sowie
die Wahl und Entlastung des Landesvorstandes.
Strukturen und Dokumente
Zwischen den Landesparteitagen findet politische Arbeit in den unterschiedlichen Strukturen der Partei statt, bspw. im Lanbdesvorstand, dem Landesausschuss und in Zusammenschlüssen. Hier finden Sie weitere Informationen zu den Strukturen und den wesentlichen Dokumenten des Landesverbandes, welche die politische Arbeit zwischen den Parteitagen konstituieren.
Die Linke vor Ort
Der Landesverband Brandenburg gliedert sich in Kreisverbände. Der Kreisverband kann die Mitglieder in einem Landkreis, in einer kreisfreien Stadt oder in mehreren territorial verbundenen Landkreisen und kreisfreien Städten umfassen. Hier findet die politische Arbeit vor Ort statt.
Jugendverband
Die Linksjugend [’solid] ist ein sozialistischer, antifaschistischer, basisdemokratischer und feministischer Jugendverband. Er greift in die gesellschaftlichen Verhältnisse ein und ist Plattform für antikapitalistische und selbstbestimmte Politik.


